Emanzipation nach der Emanzipation. Jüdische Geschichte, Literatur und Philosophie von 1900 bis heute.
Ankündigung: Internationale Abschlusstagung »Jüdische Emanzipationsdiskurse von 1945 bis heute«
der DFG-Netzwerkgruppe
»Emanzipation nach der Emanzipation.
Jüdische Literatur, Philosophie und Geschichte
von 1900 bis heute«
9. – 11. September 2025
an der Universität Augsburg in Kooperation mit der Universität Bar Ilan, Israel
Leitung:
Prof. Dr. Bettina Bannasch (Augsburg)
Prof. Dr. George Y. Kohler (Ramat Gan)
Um eine persönliche Anmeldung wird unter
juedische.emanzipationsdiskurse@philhist.uni-augsburg.de
gebeten
Lange nach der rechtlichen Gleichstellung der Juden im 19. Jahrhundert, nach der neuen Welle des Antisemitismus und den Debatten um die jüdische Beteiligung am Ersten Weltkrieg, nach Zionismus und Assimilation, nahm der Emanzipationsgedanke nach 1933 und besonders 1945 noch einmal eine ganz neue Bedeutung an. War die zunehmende Entrechtung der Juden durch das Nazi-Regime anfangs als Rückkehr ins (auch kulturelle) Ghetto empfunden worden, so brachte die Shoah nach 1945 die grundsätzliche Frage nach der Möglichkeit, „deutsch“ und „jüdisch“ überhaupt in Verbindung zu bringen, zu entschiedenster Radikalität: Nicht nur das Scheitern der Emanzipation musste nun diskutiert werden, sondern vielmehr auch ihre Realisierbarkeit als solche – und damit einhergehend das: Wie weiter? Unter welchen Bedingungen können Juden wieder in Deutschland leben – nun geteilt in Ost und West? Ist die Entscheidung gegen Deutschland und für Israel eine emanzipatorische Aussage? Haben sich deutsche Juden in Israel assimiliert und hat die Existenz Israels emanzipatorische Wirkung auf Juden in Deutschland?
Die Tagung widmet sich diesen Fragen – bis in die Gegenwart hinein mit ihren Debatten um jüdische Desintegration und die De-Sakralisierung der Vergangenheit. Die beiden Abendveranstaltungen thematisieren die Situation nach dem 7. Oktober 2023 und geben Gelegenheit zum Gespräch mit dem Autor und Historiker Doron Rabinovici, mit der Direktorin des Jüdischen Museums Frankfurt a.M., Mirjam Wenzel, und mit der Publizistin Laura Cazés.
Die Abschlusstagung will eine Zusammenschau der Erträge leisten, die im Rahmen der Gruppentreffen erarbeitet wurden und diskutiert diese in einem internationalen wissenschaftlichen Forum mit assoziierten und externen Gästen.
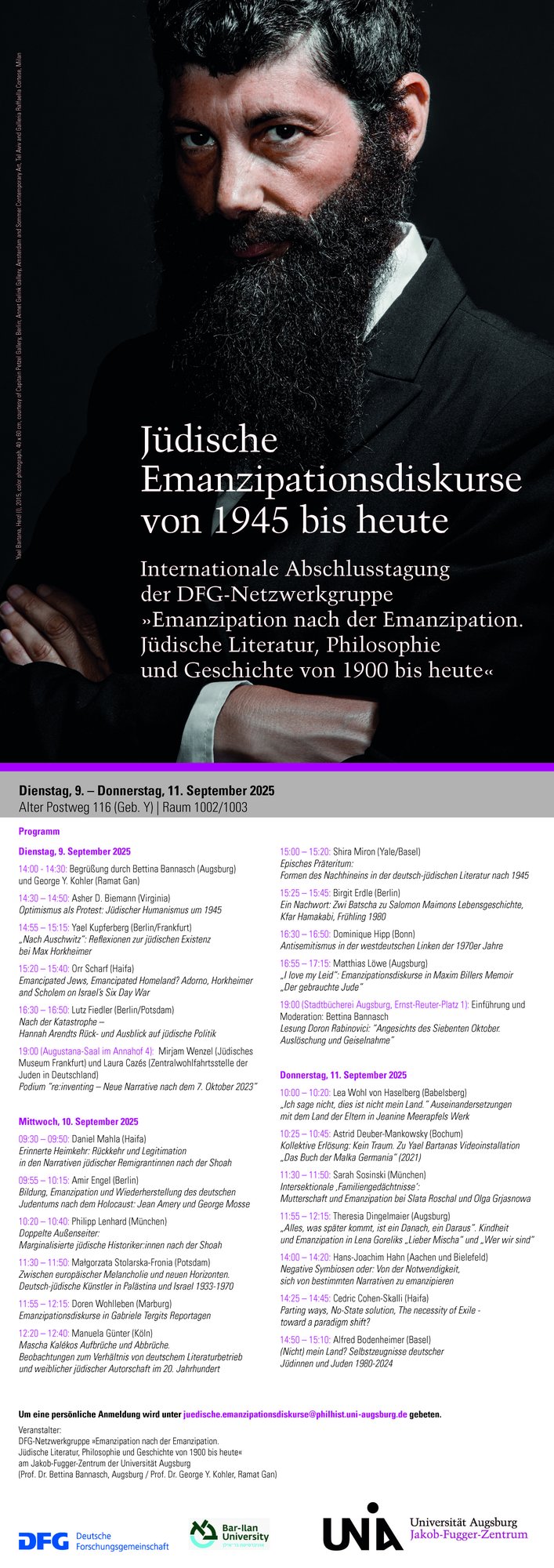
Das Projekt
Ausgehend vom jüdischen Emanzipationsdiskurs des 19. Jahrhunderts und dessen enger Verschränkung mit angrenzenden Emanzipationsdiskursen – der Frauen, des ‚vierten Standes‘, der Jugend, auch der ‚Emanzipation des Fleisches‘ –, fragt das Projekt der interdisziplinär zusammengesetzten, trilateralen Arbeitsgruppe (Israel, Deutschland, USA) nach der Fortsetzung dieser Diskursformation/en nach 1918 bzw. nach ihrer Aufhebung in angrenzenden Diskursformationen nach 1933. An den Werken vieler jüdischer Autorinnen und Autoren in der Zeit der 1920er Jahre und danach lässt sich zeigen, wie stark der Emanzipationsgedanke programmatische Texte zur ‚Judenfrage‘ auch nach der Zäsur des Ersten Weltkriegs noch prägt. Zugleich lässt sich in der Literatur und Philosophie nach 1933 nachvollziehen, auf welche Weise Konzeptionen von (jüdischer) Emanzipation im 20. Jahrhundert auf die Brüche reagieren, die durch die Erfahrung von Entrechtung, Exil und Shoah gegeben sind.
Das Projekt ist gegliedert in zwei Arbeitsphasen, deren erste sich schwerpunktmäßig mit den Jahren 1900–1933 befasste und bis auf ein Arbeitstreffen im Juli 2021 und die geplante Abschlusstagung im Februar 2022 bereits abgeschlossen ist, und die zweite Arbeitsphase, die sich mit den Jahren 1933 bis zur Gegenwart befasst. Für die erste Abschlusstagung (Teilband I) sowie für die zweite Arbeitsphase mit vier Workshops und Abschlusstagung (Teilband II) wird eine Netzwerk-Förderung bei der DFG beantragt.
1. Leitfragen der ersten Arbeitsphase waren: In welcher Weise formiert sich die Enttäuschung über den von vielen Juden als gelungen, von vielen aber auch als gescheitert erlebten Prozess der jüdischen Emanzipation im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts zu einem Diskurs, in dem die (Wieder-)Gewinnung jüdischen Selbstbewusstseins sich als ‚Jüdische Renaissance‘ die im 19. Jahrhundert weitgehende Integration in die und Assimilation an die christliche Mehrheitsgesellschaft wieder rückgängig zu machen versucht? Lassen sich wechselseitige Beeinflussungen zwischen christlichen und jüdischen Erneuerungsbewegungen nachzeichnen und ihr Niederschlag in (religions-)philosophischen und literarischen Werken näher bestimmen und auswerten im Blick auf ein differenzierteres Verständnis der jüdischen Emanzipationsbewegung in den unterschiedlichen Judentümern im Deutschland der Zwischenkriegszeit? Und schließlich: in welcher Weise artikulieren sich jene Strömungen im deutschen Judentum, die den Emanzipationsprozess nicht als gescheitert begreifen und sich, zum Teil mit scharfer Polemik, von Vertreterinnen und Vertretern der ‚Jüdischen Renaissance‘ abgrenzen?
2. Für die zweite Projektphase sind folgende Fragen leitend: In welcher Hinsicht ist der Emanzipationsgedanke in den Jahren nach 1933 noch brauchbar? Lassen sich anhand (religions-) philosophischer und literarischer Werke der deutschsprachigen und für den deutschsprachigen Diskurs relevanten Texte, zunehmend auch Filme und Serien, Entwicklungen nachvollziehen, die in eine Emanzipation vom „deutschen Gedächtnistheater“ führen? Wie verhält sich die Rede vom „Zivilisationsbruch“ zu Kontinuitäten und Bezugnahmen auf einen (vermeintlich?) dialogischen Austausch und eine (scheinbar?) geteilte Tradition vor und nach 1933? In welchem Verhältnis stehen deutschsprachige Kultur und Geschichte in Israel zu den beiden deutschen Erinnerungsdiskursen in Ost und West? Wie lässt sich das Verschmelzen der beiden deutschen Erinnerungsdiskurse beschreiben, welche Konsequenzen leiten sich daraus ab? Lässt sich mit der „Wende“ ein Abwenden vom ‚Emanzipationsparadigma‘ verzeichnen, ein Denken, das den „Zivilisationsbruch“ als „Stunde Null“ setzt? Oder sind in der Verbündung der jungen jüdischen Bewegung in Deutschland mit angrenzenden Emanzipationsbewegungen – von Muslima/en, Frauen, People of Color – vergleichbare Verschränkungen zu beobachten, wie sie in den Emanzipationsdiskursen des 19. Jahrhunderts erkennbar sind? Finden sich Formen der (Rück)Besinnung auf religiöse Identitäten, wie sie auch für das erste Drittel des 20. Jahrhunderts charakteristisch sind? Erhält die Emanzipation von der Emanzipation, die sich in der Bewegung der ‚Jüdischen Renaissance‘ vor 1933 ausmachen lässt, nach 1945 aus der Perspektive der Erfahrung der Shoah den ahistorischen Charakter des ‚Prophetischen‘, der alternative jüdische Positionsbestimmungen insbesondere im assimilierten Judentum als ‚naiv‘ erscheinen lässt? Lassen sich im gegenwärtigen Diskurs Revisionen dieser ‚Schieflage’ ausmachen, etwa wenn Autoren wie Maxim Biller sich prononciert und programmatisch auf Vorbilder wie Kurt Tucholsky beziehen, der auch angesichts der existentiell bedrohlichen Judenverfolgungen im nationalsozialistischen Deutschland vehement darauf beharrte, sich nicht der jüdischen Leidensgemeinschaft anzuschließen, sondern „im Jahre 1911 ‚aus dem Judentum ausgetreten‘“ zu sein? In welcher Hinsicht lassen sich Parallelen und Differenzen zu aktuellen Diskursen ausmachen? Und wie sind diese fruchtbar zu machen für historische Perspektivierungen der Debatten der Zwischenkriegszeit und aktueller Debatten? In der zweiten Projektphase dienen neben philosophischen und literarischen Zeugnissen als wichtige Indizien für diese Entwicklungen ab 1933 unterschiedliche Formen der Vermittlung in Museen, im Theater, im Schulunterricht etc.
Die Leitung des Gesamtprojekts liegt bei Prof. Dr. Bettina Bannasch (NdL, UA) und Prof. Dr. George Kohler (Jüdische Religionsphilosophie, Bar Ilan). Das Projekt ist am Jakob-Fugger-Zentrum für Geisteswissenschaften an der Universität Augsburg angesiedelt und wird seit 1.1.2022 als Netzwerkgruppe von der Deutschen Forschungsgemeinschaft gefördert.
Netzwerkgruppe trauert um Prof. em. Itta Shedletzky (1943-2023)
Im Sommersemester 2013 hatte Prof. Itta Shedletzky die erste internationale Gastprofessur am Jakob-Fugger-Zentrum inne. Wie kaum eine andere verkörperte sie in ihren Forschungen und ihrem Leben den Gedanken der Transdisziplinarität und -nationalität.
In Zürich geboren und zur Schule gegangen – Max Lüthi war einer ihrer Deutschlehrer -, ging sie als junge Frau nach Jerusalem, um dort an der Hebrew University Geschichte und Anglistik zu studieren. Ihre Dissertation zu deutsch-jüdischen Zeitschriften im 19. Jahrhundert entstand bei dem Historiker Jakob Katz. Für ihre Lehrtätigkeit wechselte sie an die Germanistische Abteilung der Hebrew University, ihre Forschungsprojekte verfolgte sie am Franz-Rosenzweig-Zentrum. Itta Shedletzky hat an zwei umfangreichen Editionsprojekten zu zentralen Figuren der deutsch-jüdischen Kultur- und Literaturgeschichte – Gershom Scholem und Else Lasker-Schüler – mitgewirkt. Sie verfasste einschlägige, inzwischen kanonisch gewordene Texte zu Kernfragen der deutschsprachig-jüdischen Literatur und Philosophie, so ihren Essay „Tradition und Existenz“ und andere.
An die Universität Augsburg kam sie auch in den folgenden Jahren regelmäßig zu Vorträgen und Lehrveranstaltungen. 2017 war sie im Rahmen eines Jakob-Fugger-Konzeptlabors an der Gründung der Arbeitsgruppe „Emanzipation nach der Emanzipation. Jüdische Literatur, Philosophie und Geschichte von 1900 bis heute“ beteiligt. Die Gruppe wird seit 2022 als DFG-Netzwerk gefördert. Seit 2018 treffen sich deutsche und israelische Nachwuchswissenschaftler:innen und Expert:innen zweimal jährlich zu Workshops und Tagungen, während der Corona-Pandemie wurde die Zusammenarbeit im Hybrid-Format fortgesetzt. Itta Shedletzky war bei jedem Arbeitstreffen mit dabei.
Die Netzwerk-Gruppe verliert mit Itta Shedletzky eine Gelehrte, der ein profundes, umfangreiches Wissen zur Verfügung stand und die über einen ungewöhnlich weitgespannten Horizont verfügte. Großzügig ließ sie alle daran teilhaben. Sie regte zu Gesprächen und einem Weiterdenken an, das von ‚letzten Worten‘ nicht viel hielt. Die Netzwerk-Gruppe wird in diesem Sinne ihre Arbeit fortsetzen.
Bettina Bannasch und George Kohler, im Namen der Mitglieder der Arbeitsgruppe.

Kontakt
- Telefon: +49 821 598 - 2778
- E-Mail: bettina.bannasch@philhist.uni-augsburgphilhist.uni-augsburg.de ()
- Raum 4031 (Gebäude D)
- Telefon: +49 821 598 - 5807
- E-Mail: George-Yaakov.Kohler@biu.acbiu.ac.il ()
- Raum 4048 (Gebäude D)

