Lebenslauf
Jens Soentgen, geboren 1967 in Bensberg, studierte Chemie (Staatsexamen 1994) und promovierte dann in Philosophie, mit einer Arbeit über den Stoffbegriff (Das Unscheinbare, Berlin 1997). Lehraufträge führten ihn anschließend an verschiedene Universitäten in der Bundesrepublik. Mehrfach war er in Brasilien als Gastdozent für Philosophie tätig. Seit 2002 ist er wissenschaftlicher Leiter des Wissenschaftszentrums Umwelt der Universität Augsburg. Seit 2016 ist Jens Soentgen Adjunct Professor of Philosophy an der Memorial University in St. John’s, Kanada (Neufundland).
Von 2012 bis 2020 war Jens Soentgen Mitherausgeber der Zeitschrift GAIA – Ökologische Perspektiven für Wissenschaft und Gesellschaft.
Einen ausführlicheren CV finden Sie hier.
Forschungsschwerpunkte
Meine Arbeit möchte dazu anregen, existentiell bedeutsame und zugleich alltägliche Naturphänomene wie z.B. das Wasser, das Feuer oder die Luft (oder auch den Staub) auf eine vertiefte Weise wahrzunehmen. Dabei ist die Phänomenologie mein methodischer Leitfaden. Die Phänomenologie orientiert sich an der alltäglichen, nichtinstrumentellen und nichtquantifizierten Erfahrung. Ergänzt wird der phänomenologische Zugang zum einen durch philosophiegeschichtliche und wissenschaftsgeschichtliche Analysen, die Ideen aufspüren, die abgelegt, vergessen oder verworfen wurden, aber ein Recycling verdienen. Die Resultate kann man als Beiträge zu einer nicht nur formalen, sondern material gehaltvollen, phänomenologischen Naturphilosophie bezeichnen. Dass diese Resultate auch für andere philosophische Arbeitsgebiete, zum Beispiel für die philosophische Anthropologie oder die Umweltethik relevant sind, liegt auf der Hand.
Neben diesen inhaltlichen Arbeiten habe ich seit meinem Studium ein starkes Interesse an methodischen Problemen. In der Methodik der Philosophie habe ich die Bedeutung der Topik gegenüber der Kritik betont und Modelle für den produktiven Einsatz der Topik entwickelt, die auch in einigen Publikationen und z.B. in meinem Buch ‚Selbstdenken‘ dargelegt sind. Im Bereich der phänomenologischen Methodik habe ich mich u.a. mit Methoden der Beschreibung und mit dem Philosophieren mit Bildern befasst.
Für die Forschung in den Environmental Humanities habe ich, zusammen mit den Kolleginnen und Kollegen am WZU die stoffgeschichtliche Methode zu einem narrativen und interdisziplinären Ansatz weiterentwickelt und in unserer Buchreihe ‚Stoffgeschichten‘, die ich gemeinsam mit dem Chemiker Armin Reller begründet habe, mehrere Paradigmen für die stoffgeschichtliche Arbeit erarbeitet (u.a. zu CO2, Stickstoff, Kautschuk, Salpeter usw.).
Schließlich bin ich als wissenschaftlicher Leiter des WZU auch als Moderator und Organisator mehrerer interdisziplinärer Forschungs- und Lehrprojekte tätig.
Viele meiner Publikationen, auch etliche Bücher sind open access verfügbar und können auf meiner Publikationsseite heruntergeladen werden.
Lehrveranstaltungen
LfU-Vortragsreihe UmweltStudium
Nach coronabedingter Pause startet die LfU-Vortragsreihe im WS 2023/2024 erneut.
Wir bieten in Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Landesamt für Umwelt und der Hochschule Augsburg im Vortragssaal des LfU die Lehrveranstaltung UmweltStudium an, die sich in jedem Semester einem grundlegenden Thema zuwendet. Dieses Semester dreht sich alles um das Thema Energie und Ökologie.
Expertinnen und Experten des LfU und Forscherinnen und Forscher geben Einblick in aktuellste Entwicklungen und praktische Umsetzungen. Die Vorträge im Wintersemester 2025/26 finden ab 13. Oktober im LfU jeweils Montags von 14 bis 15:30 Uhr statt. Die Veranstaltung ist kostenlos. Nähere Informationen bietet das Vortragsprogramm .
| Kurs | Heimateinrichtung | Dozent | Semester | Typ | Sprache |
|---|
Publikationen
Neu erschienen:
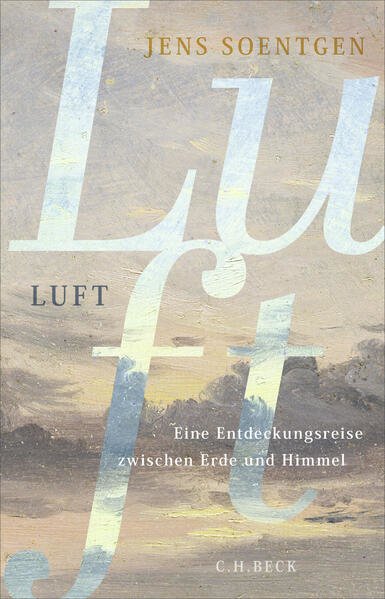
C.H. Beck, 320 Seiten.
Wir sind von Luft umgeben und würden ohne sie nicht überleben. Wir teilen sie mit allen Menschen, mit allen Pflanzen und Tieren, denn alles, was lebt, atmet Luft. Aber diese Zusammenhänge mussten erst einmal entdeckt, erforscht und eingeordnet werden. Dieses Buch erzählt erstmals die Entdeckungsgeschichte der Luft – von der Antike bis zur Gegenwart, von den Launen der Wettergötter bis zur globalen Erwärmung.

Zug: Die Graue Edition, 273 Seiten.
Wasser ist an der Oberfläche durchsichtig und licht; in der Tiefe wird es rasch dunkel. Über keine andere Substanz wissen wir so viel und so wenig zugleich. In alchemistischen Texten wird das Wasser als ‚Mutter‘, manchmal auch als ‚Hermaphrodit‘ verrätselt. Beide Sinnbilder werden in diesem Buch erläutert – auf der Grundlage der Ergebnisse der modernen naturwissenschaftlichen Wasserforschung. Der Text verbindet Imagination und Fakten, integriert altes und neues Wasserdenken und gelangt so zu einem neuen Verständnis des Phänomens Wasser. Werke der Künstlerin Stefanie Zoche begleiten den Text.

Soentgen, Jens (2024): Indigenous Knowledge and Material Histories
Cambridge University Press, 75 Seiten, Englisch
This Element deals with stories told about substances and ways to analyse them through an Environmental Humanitie's perspective. It then takes up rubber as an example and its many stories. It is shown that the common notions of rubber history, which assume that rubber only became a useful material through a miraculous operation called vulcanization, that is attributed to the US-American Charles Goodyear, are false. In contrast, it is shown that rubber and many important rubber products are inventions of Indigenous peoples of South America, made durable by a process that can be called organic vulcanization. It is with that invention, that the story of rubber starts. Without it, rubber would not exist, neither in the Americas nor elsewhere. Finally, it is shown that Indigenous rubber products also offer some ecological advantages over industrially manufactured ones.

Roth, Peter und Soentgen, Jens (2024): Henricus Nollius: Hermetische Physik
Norderstedt: PubliQation, 208 Seiten.
Veröffentlicht durch die Universität Augsburg.
Das Buch ist als Open Access bei der Universitätsbibliothek Augsburg verfügbar unter:
https://doi.org/10.22602/IQ.9783745888522

Soentgen, Jens (2022): STAUB - Alles über fast nichts
Dtv, 2022, 192 Seiten
Book ISBN 978-3-423-26344-3
Preis: 15,00 € inkl. MwSt.
„Es ist letztlich eine Kritik der instrumentellen Vernunft, die hier so originell wie sachkundig vorgetragen wird: Je mehr Staub der Mensch mit seinen Produktionen aufwirbelt, desto heftiger sägt er am Ast seiner angemaßten Herrlichkeit. Die gute Nachricht dabei: Manches scheint reversibel. Dicke Luft kann auch wieder dünner werden, erste Schritte sind mit Feinstaubfiltern, Dachbegrünungen und anderen regenerativen Maßnahmen bereits in die Wege geleitet.“
Thomas Groß, Deutschlandfunk Kultur, 8.11.2022.
Wenn wir über Staub sprechen, dann gibt es meist ein Problem: Hausstaub löst Allergien aus, Feinstaub belastet die Stadtluft, Aerosole transportieren gefährliche Viren. Doch die kleinen Teilchen können noch viel mehr: Staubböden sind sehr fruchtbar, der Amazonasregenwald ist auf die Düngung durch Saharastaub angewiesen und ohne Staub in der Luft wäre es um einiges finsterer auf der Erde.
Eine Rezension finden Sie hier:
Weitere Informationen zu diesem Titel erhalten Sie hier.

Soentgen, Jens (2021): Pakt mit dem Feuer: Philosophie eines weltverändernden Bundes
Matthes & Seitz, 2021, 223 Seiten
Book ISBN 978-3-7518-0340-3
Preis: 22,00 € inkl. MwSt.
Der prometheische Pakt, die Kraft der Negation und der Mensch als umweltveränderndes Wesen – und Feuer als das verbindende Prisma, durch das sich die Gefahren unserer Gegenwart besser beleuchten lassen.
Die Feuer, die in Australien, Kalifornien oder Brandenburg seit einigen Jahren ganze Landstriche Sommer für Sommer heimsuchen, sind verheerend. Noch größer sind jedoch die ganz alltäglichen Feuer, die in technischen Anlagen am Rande oder inmitten der modernen Metropolen, insbesondere in Asien, Amerika und Europa brennen: in Kraftwerken, in Hochöfen, in Zementwerken, in Industrieanlagen und nicht zuletzt auch in jenen rund 1,4 Milliarden Verbrennungsmotoren, mit denen weltweit Menschen und Waren bewegt werden. Alle diese Feuer müssten in diesem Jahrzehnt auf weniger als die Hälfte zurückgefahren werden, in zwanzig, spätestens in dreißig Jahren dürfte keines mehr brennen, wenn der Klimawandel noch beherrschbar bleiben soll. Ob und wie dies möglich ist, ist dabei nicht nur eine naturwissenschaftliche und technische, sondern auch eine philosophische Frage. Denn das Feuer ist nicht irgendein Hilfsmittel, es ist vielmehr die universelle Technik schlechthin, mit der Menschen ihre künstlichen Umwelten nicht nur schaffen, sondern auch betreiben: Menschen machen Feuer, und Feuer macht auch Menschen. Welche Rolle spielt das Feuer in der Natur? Was hat das Feuer für die Menschen so attraktiv gemacht, dass sie ihm bis heute die Treue halten? Und wie ließe sich der Big Burn, der unser Zeitalter auszeichnet, reduzieren, um zumindest einen Teil der Natur vor den Zerstörungen der feuernutzenden Menschen zu retten?
Weitere Informationen zu diesem Titel erhalten Sie hier.
Eine Buchbesprechung finden Sie hier.

